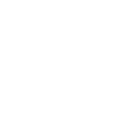„Honig – Preiswerte überraschen“
Stiftung Warentest, Ausgabe 04/2025
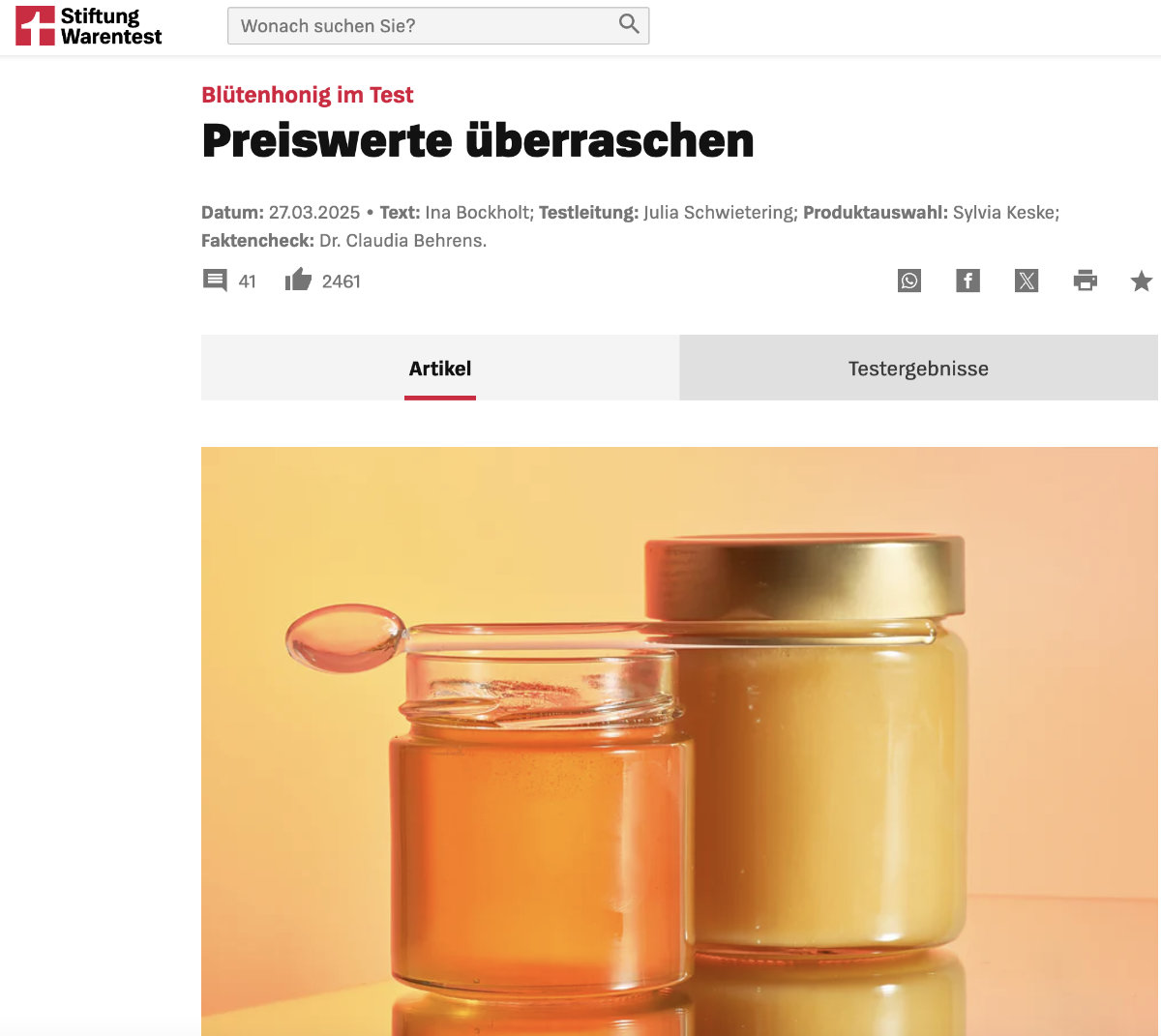
Gemeinsame Stellungnahme des Deutschen Erwerbs- und Berufsimkerbund e.V. und Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Mit Erstaunen haben wir den Honig-Test der Stiftung Warentest (April 2025) gelesen. Weder wissenschaftliche Standards noch journalistische Sorgfalt werden hier eingehalten – ein Test, der seinen Namen nicht verdient.
Die Bewertung der Analysen wird an vielen Stellen auf den Kopf gestellt und das Ergebnis ins Gegenteil verkehrt. Während z. B. in der Honigsensorik bei Discounterhonigen klare Fehlarmomen nicht bewertet wurden, führten honigtypische und authentische Eigenschaften bei einem deutschen Imkerhonig zur Abwertung.
Insgesamt wirkt dieser Test, insbesondere vor dem Hintergrund der bisherigen EU-weiten Aufdeckungen von Honigverfälschungen, wie bestellt – ein Gefälligkeitsurteil. Stiftung Warentest ist längst kein unabhängiger Akteur mehr: Wirtschaft und Politik geben den Ton an. Seriös getestet wurde hier nicht – mindestens 10 von 24 Honigen, darunter Lidl (Platz 3) und Aldi Nord (Platz 5), hätten beim Sensoriktest ausgeschlossen oder zumindest mit mangelhaft bewertet werden müssen. Von den unzähligen handwerklichen Fehlern und wissenschaftlich ungenügenden Vorgehensweisen greifen wir im Folgenden nur zwei der gravierendsten heraus, um die Tragweite der Manipulation deutlich zu machen.
Stiftung Warentest blamiert sich bei sensorischer Beurteilung
Vergleich von „Äpfel mit Birnen“
Im Test wurden deutsche Blütenhonige zusammen mit Mischhonigen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten verglichen, ohne Kenntnis der genauen geografischen oder botanischen Herkunft. Aus einer solchen, nahezu unbegrenzten Vielfalt sensorischer Merkmale kann jedoch nichts korrekt abgeleitet werden. Man braucht immer einen Vergleichsstandard, um zu beurteilen, ob diese Blütenhonig-Mischungen typisch schmecken oder sensorische Fehler aufweisen. Mit anderen Worten: Man kann keinen deutschen Blütenhonig mit einem Mischhonig aus dem Ausland ohne Referenz sensorisch vergleichen.
Es stellt sich die Frage, welche Referenzproben bei dieser Bewertung verwendet wurden, um Abweichungen überhaupt bewerten zu können?
Fachbegriffe in negativem Kontext
Eine sensorische Analyse ist zunächst wertneutral. Es wird beschrieben, was wahrgenommen wird. Im Test wurden „animalische“ und „stallige“ Aromen pauschal als Fehler eingestuft und durchgängig in einen negativen Rahmen gesetzt. Diese Beschreibungen sind jedoch zentrale Fachbegriffe aus der internationalen sensorischen Analyse und die Aromen wichtige Kennzeichen der Authentizität bestimmter Blütenhonige. So zeigt der immer beliebtere Buchweizenhonig, als typisches Kennzeichen für einen authentischen Sortenhonig, eine animalische, an Pferdestall erinnernde Geruchskomponente, unabhängig vom sensorischen und geschmacklichen Gesamteindruck.
Es stellt sich die Frage, warum gerade diese von ungewohnten und im Allgemeinen eher als negativ empfundenen Begriffe hier direkt mit einem Fehler verknüpft werden? Viele positiv klingende Begriffe aus der Sensorik wie fruchtig, zitrusartig, blumig und warm kommen dagegen gar nicht vor. Gerade bei den getesteten deutschen Imkerhonigen müssten diese Aromen aufgrund ihrer Herkunft beschrieben sein. Selbst beim Testsieger würden wir zumindest blumige Geschmackskomponenten erwarten.
Rauch bei Discounterhonig nicht abgewertet
Bei 10 von 24 Honigen wurden Rauchnoten festgestellt. Obwohl nach internationalen Standards rauchige Aromen in Blütenhonigen in der Regel als „Off-Flavours“, d.h. Fehlaromen, und damit als Ausschlusskriterium zu bewerten sind, haben die Prüfer keine Abwertung vorgenommen. Rauch ist Zeichen einer fehlerhaften Verarbeitung, nicht natürlich und daher als erheblicher Mangel zu bewerten. Stiftung Warentest akzeptiert diese Fehlaromen interessanterweise z.B. bei den gut platzierten Honigen von Lidl, Aldi, Edeka und Langnese. Nach internationalen Standards wären diese 10 Honige bereits jetzt durchgefallen und mit ungenügend zu bewerten.
Es stellt sich die Frage, warum dieses klare Ausschlusskriterium nicht angewendet wird?
Kohl-Aroma bei deutschem Imkerhonig abgewertet, beim Testsieger nicht
Sortentypisch sind auch pflanzliche und kohlartige Aromen bei bestimmten Blütenhonigen wie Raps. Ein deutscher Blütenhonig vom Imker im DIB-Glas wurde mit diesem Aroma jedoch als untypisch und fehlerhaft abgewertet. Beim Testsieger hingegen fand diese Abwertung nicht statt. Auch dieser Honig ist ein Blütenhonig und hätte somit ebenfalls abgewertet werden müssen.
Es stellt sich die Frage, warum die Prüfer gleiche Aromen bei vergleichbaren Honigen unterschiedlich bewerten?
Stiftung Warentest verwendet veraltete Methodenauswahl
Der im Artikel zitierte Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund hat die DNA-Analyse im Oktober 2024 öffentlich in die Diskussion gebracht, um den immer raffinierteren Fälschungen besser auf die Spur zu kommen. Denn mittlerweile sind die in diesem Test angewendeten, „anerkannten“ Methoden eben nicht mehr fälschungssicher. Genau das hat auch das JRC (Joint Research Center) der EU-Kommission erkannt. Bei der im Test-Artikel ebenfalls referenzierten EU-Kontroll-Aktion „From the Hives“ wurden deshalb nicht nur erstmals mehrere Verfahren kombiniert, sondern auch aktuelle, dem wissenschaftlichen Stand der Technik entsprechende und auch neue Methoden angewandt:
- 1H-NMR (Nuclear Magnetic Resonance Profiling) (Honey-ProfilingTM nach Bruker)
- LC-HRMS (Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry)
- EA/LC-IRMS (Elemental Analyzer/Liquid Chromatography-Isotope Ratio Mass Spectrometry)
- HPAEC-PAD (High-Performance Anion-Exchange Chromatography with Pulsed Amperometric Detection)
Keine HPAEC-PAD
Warum gerade die zentrale Nachweismethode der EU-Kommission (HPAEC-PAD, High-Performance Anion-Exchange Chromatography mit Pulsed Amperometric Detection) von Stiftung Warentest vollständig außer Acht gelassen wird, wirft erhebliche Fragen auf. Denn genau diese Methode trug maßgeblich zur Aufdeckung der damals schon unglaublich hohen Rate von 46% auffälliger Honigproben bei. Das bewusste Auslassen einer so wesentlichen Technologie erscheint aus wissenschaftlicher Perspektive nicht nachvollziehbar und beeinträchtigt die Aussagekraft der Resultate erheblich.
Verzicht auf 1H-NMR-Spektroskopie nach Bruker
Warum verwendet die Stiftung Warentest eine offenbar veraltete NMR-Methode, die erst bei 15% Verfälschungsgrad anschlägt, wenn es doch bereits seit Jahren eine validierte und weltweit etablierte, hochauflösende NMR-Methode gibt (¹H-NMR-Spektroskopie von Bruker)? Die Bruker Honey-Profiling-MethodeTM erkennt zuverlässig Abweichungen vom Reinheitsgrad sowie falsche Herkunfts- und Sortenangaben mithilfe einer globalen Datenbank von rund 28.500 Referenzproben aus über 50 Ländern.
Es stellt sich die Frage, warum diese beiden modernen und gerade für die Fälschungsaufdeckung besonders wichtigen Analysemethode nicht angewendet wurden?
Auf diese Weise werden die Testergebnisse systematisch und erheblich verzerrt, was den Schluss nahelegt, dass Stiftung Warentest gar keine Verfälschungen finden wollte.
Verzicht auf die DNA-Methode
Darüber hinaus verzichtet die Stiftung Warentest auf eine weitere bewährte und offiziell anerkannte Methode. Die DNA-Analyse ist im BVL-Handbuch der amtlichen Untersuchungsmethoden (L 40.00-14 / 2012-07 zur Präparation von DNA aus Honig) gelistet und validiert. Sie entspricht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand der Technik und es kann und darf unter objektiven Gesichtspunkten keine Ablehnung der Methode geben. Das Ignorieren wissenschaftlich etablierter Methoden lässt Voreingenommenheit vermuten und untergräbt die Glaubwürdigkeit des gesamten Tests.
Stiftung Warentest: alles andere als neutral
Die Stiftung Warentest gibt sich als neutrale Instanz. Sie wurde etabliert als Verbraucherschutzinstitution und hat sich einen guten Ruf erarbeitet. Sie genießt Vertrauen und gilt als unabhängig. Doch Verwaltungsrat und Kuratorium sind von Staatsbediensteten und Wirtschaftslobbyisten besetzt, Vertreter der Industrie vom BDI über den Markenverband bis zum Handelsverband Deutschland. Diese Strukturen lassen tief blicken, denn das Kuratorium kann bestimmen, was getestet wird und was nicht!
Der einstmals gute Ruf der Testredaktion wird nun offenbar gezielt benutzt und missbraucht. Testablauf und Testergebnis genügen keinesfalls der wissenschaftlichen Sorgfalt. Wir sehen den Test als einen politisch motivierten Gefallen, der die Glaubwürdigkeit neuer Testverfahren diskreditiert und Honigverfälschungen legitimieren soll.
DBIB und LVRPF, 02.04.2025